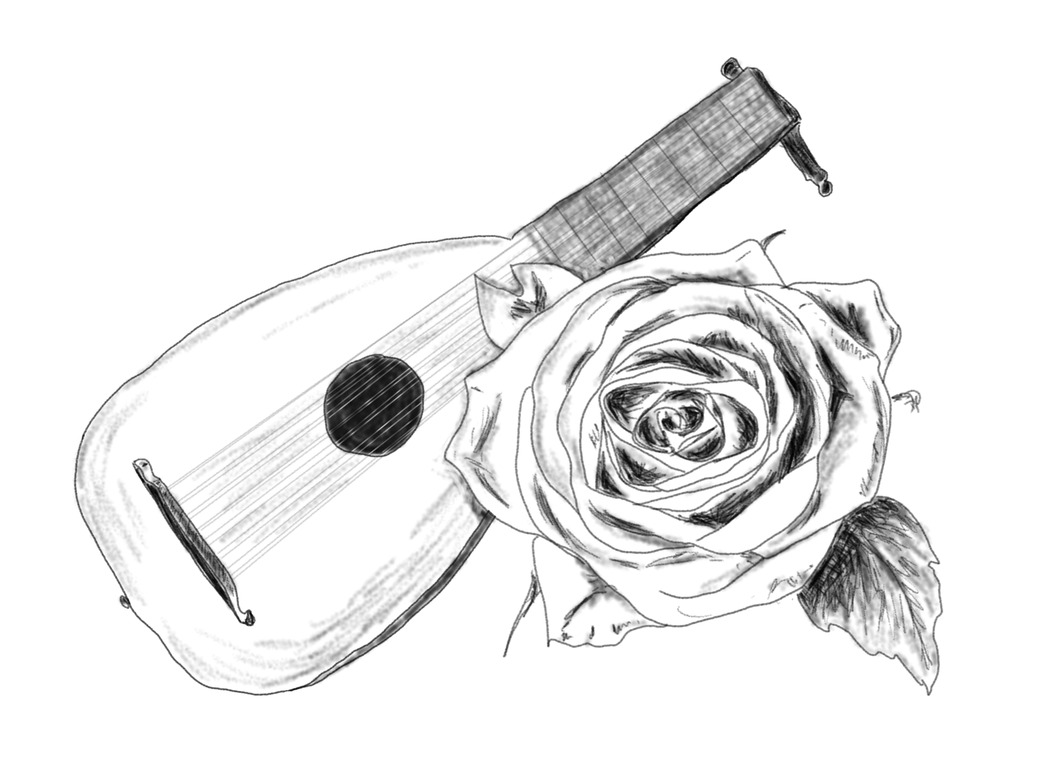
Die Aufregung weckte mich. Ich war so plötzlich wach, als hätte jemand einen Vorhang aufgezogen und das Licht hereingelassen. Dabei war das Stückchen Himmel, das ich durch die Dachluke sehen konnte, noch dämmrig. Die Aufregung war der Grund, warum ich ewig gebraucht hatte, um einzuschlafen, und sie sorgte auch jetzt dafür, dass ich sofort wusste, wo ich mich befand: Auf einem Heuboden, oberhalb eines Stalls – mehr hatten wir uns nicht leisten können. Mitten in Garenien. Nur wenige Stunden Fußmarsch von Kronprinz Leonards Schloss entfernt.
Einen halben Tag Fußmarsch von Henrietta entfernt, die als Gouvernante die Kinder des Kronprinzen von Garenien betreute.
Vorsichtig hob ich Joakims Arm an, den er oberhalb der Decke um meine Mitte geschlungen hatte, und drehte mich auf die Seite, um ihn anzusehen. Er atmete langsam und gleichmäßig, das Gesicht vollkommen entspannt. Nur die dichten Wimpern zitterten leicht, bewegt durch unsichtbare Traumbilder. In seinen dunklen, zerzausten Haaren hatte sich Stroh verfangen. Haare, die schon wieder recht lang waren. Warum war es mir nicht früher aufgefallen? Vielleicht … Vielleicht hätte ich sie ihm sogar selbst kürzen können.
Der Gedanke ließ ein Kribbeln in meinem Bauch aufsteigen. Unwillkürlich streckte ich die Hand aus und wickelte mir vorsichtig eine der Strähnen um den Finger. Ja, mir würde es auf jeden Fall gefallen. Nicht nur, dass ich beeinflussen konnte, wie er aussah, sondern überhaupt – ihm dabei so nah zu sein, die Finger immer und immer wieder in seinen Haaren vergraben zu dürfen.
Aber nicht jetzt. Ich verscheuchte den Gedanken, es würde bis nach dem Besuch warten müssen. Jetzt war keine Zeit für Verzögerungen, immerhin waren wir verabredet.
Es würde das erste Treffen zwischen Joakim und Henrietta sein. Letztes Mal – war es bereits zwei Wochen her? – war ich allein bei ihr gewesen. Wir hatten so viel zu erzählen gehabt. Zu beraten. Zu entscheiden und … umzusetzen. Wovon ich Joakim immer noch nichts erzählt hatte.
Aber auch das war keine Angelegenheit für heute. Heute war die größte und entscheidendste Frage, wie Henrietta und Joakim sich miteinander verstehen würden. Ich war auch so schon aufgeregt genug.
Genug, um mich endlich auf den Weg machen zu wollen. Jetzt musste ich nur noch Joakim wach bekommen – und das möglichst sanft, um seine Morgenstimmung nicht zu verschlechtern. Also vielleicht besser nicht wieder über die Wange streicheln. Letztes Mal war er davon geradezu panisch aus dem Schlaf geschreckt, als hätte ich ihn angegriffen.
Probehalber strich ich stattdessen über seine Hand auf meiner Hüfte, verschränkte meine Finger mit seinen. Ich zog sie an meine Lippen, küsste die Knöchel. Es brachte seinen Atemrhythmus durcheinander. Sein einer Fuß zuckte leicht. Immerhin. Ich wartete noch zwei Atemzüge, dann öffnete er tatsächlich verschlafen die Augen.
„Guten Morgen.“ Ich versuchte mich an einem Lächeln, merkte jedoch selbst, dass es eher zu einem sehr breiten Grinsen wurde.
Joakim stöhnte und presste die Lider wieder zusammen. „Jetzt schon aufstehen?“
„Schon längst.“
„Du bist furchtbar, wenn du dich auf etwas so sehr freust“, brummte er. „Ich sollte dringend alles Gute von dir fernhalten.“
„Ich dachte, ich bin furchtbar – Punkt. Ohne Bedingung.“
„Stimmt.“ Seine Mundwinkel zuckten.
Ich grinste und drückte einen weiteren Kuss auf seine Hand.
Seine Augen flogen sofort wieder auf, sein dunkler Blick durchbohrte mich regelrecht. Vielleicht nahm er jetzt erst wirklich wahr, was genau ich da tat. Dass ich seine Finger küsste. Kein eleganter Handkuss zur höflichen Begrüßung, keine ironische, übertriebene Variante davon und auch keine bewusst neckende, zweideutige. Sondern einfach nur … so.
Und das, ging mir auf, war das eigentlich Verwunderliche. Deswegen Joakims Blick. Auf eine seltsame Weise war das hier, die Beiläufigkeit, sogar noch intimer als gezielte, hungrige Küsse. Weil ich nicht darüber nachgedacht hatte. Das hier war … tiefer. Fundamentaler. Eine ganz andere Ebene. Keine Frage mehr, sondern eine Bestätigung. Eine unglaubliche, wundervolle Selbstverständlichkeit.
Joakim löste die Finger von meinen, schmiegte die Handfläche stattdessen an meine Wange. „Dir auch einen guten Morgen“, murmelte er. Leichte Fältchen zerknitterten seine Augenwinkel.
Mir war plötzlich warm, richtig wohlig warm.
Es war geradezu verwirrend einfach mit ihm. Verwirrend wie leicht es gewesen war, alles hinter uns zu lassen. Wir waren vor gut einem Monat vom Maskenball geflohen; hatten so viele verstrickte Fäden zwischen zwei Königreichen zurückgelassen und uns nicht darum gekümmert, sie aufzulösen. Zwar konnten wir Sahrmingen seitdem nicht mehr betreten, weil mein Vater dort nach uns suchen ließ. Aber zu unserem Glück hatte König Laurent nicht nachgezogen. Vielleicht wusste er, dass er Joakim auf diese Weise nicht zur Rückkehr bewegen konnte.
Also hatten wir jetzt unsere eigene Welt, fern von politischen Verwirrungen und Plänen. Genau so, wie wir es vereinbart hatten. Ein echter Neuanfang. Wir hatten nie festgelegt, wie lange wir eigentlich in der Hütte bleiben wollten, und inzwischen war es ganz von alleine zu unserem Leben geworden. Unserem gemeinsamen Leben. Es war besser, als ich es mir je geträumt hätte.
Joakim strich mir mit dem Daumen über die Stirn, glättete sie sanft. „Worüber denkst du nach?“
Ich pflückte seine Hand ab. „Warum wir immer noch nicht auf dem Weg sind.“ Ich setzte mich auf und warf ihm ein Lächeln zu. „Komm. Es wird Zeit, dass du meine wahre Familie triffst.“
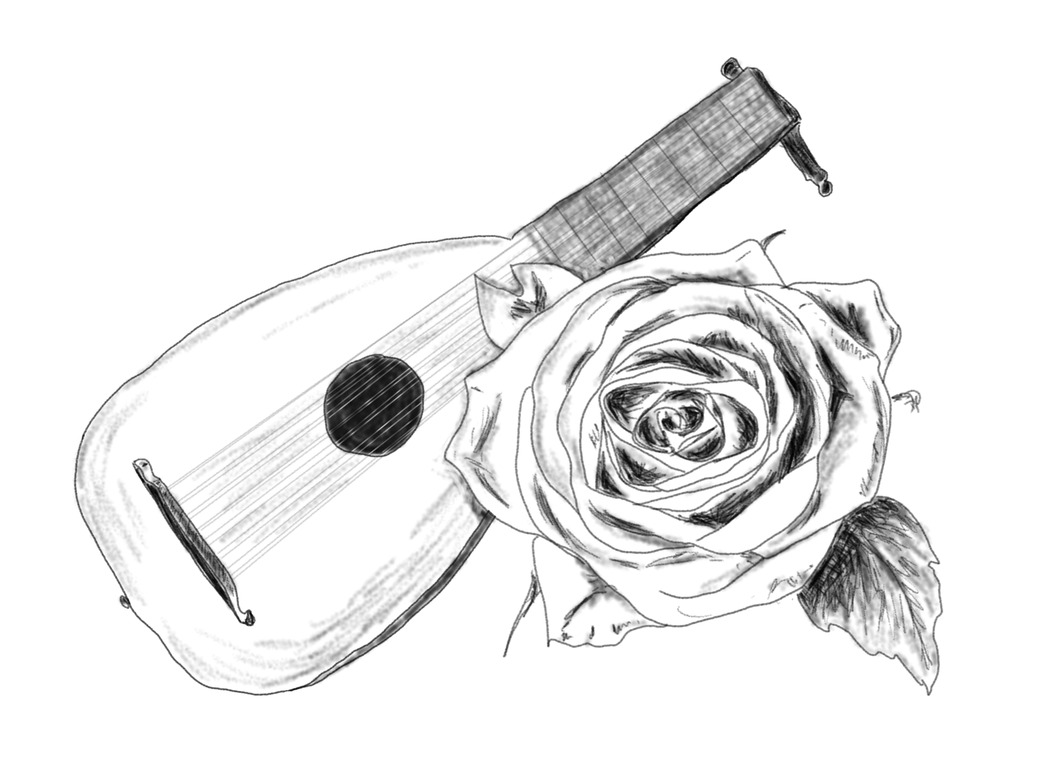
Die Nacht war erneut kalt genug gewesen, um silbernen Raureif auf den Grashalmen zu hinterlassen. Selbst nach zwei Stunden wandern, zierten immer noch einige Reste den Wegesrand. Sie verschwanden erst, als die Abstände zwischen den vereinzelten Häusern kürzer wurden, wir der Hauptstadt näher kamen. Die Gebäude waren hier anders als in Sahrmingen oder Agarmundt. Sie besaßen flache Dächer, statt spitze, und ihre Fassaden waren mit bunten Scherben geschmückt. Manchmal ergaben sie sogar Muster oder übermannsgroße Bilder, die mich auch jetzt beim zweiten Besuch wieder faszinierten. Nach den vielen Tagen im Wald mit ähnlichem Ablauf und dem Besuch derselben Dörfer ringsum, sog ich jedes neue Detail in mich auf. Wenn ich gekonnt hätte, hätte ich die Reise ausgedehnt. Nicht nur dieser kurze Besuch, sondern mehr Tage hier verbracht, mehr Städte bereist, vielleicht sogar gleich weitere Länder.
Aber reisen war zu kostspielig: Zu Beginn der Reise war der Beutel auf meinem Rücken noch voll mit Tonwaren gewesen, sorgfältig in Tücher eingewickelt, damit sie nicht zerbrachen. Doch ich hatte sie gestern verkauft, weil wir einen Teil der Einnahmen für die Unterkunft benötigt hatten. Die Arbeit von Tagen innerhalb einer Nacht verbraucht.
Mechanisch tastete ich nach dem beinahe leeren Beutel. Jetzt war er bis auf die Tücher und ein kleines, weiches Bündel leer. Gut, mein Geschenk für Henrietta war noch da. Natürlich war es noch da, schließlich konnte es sich nicht einfach in Luft auflösen. Himmel, ich war einfach zu nervös. Aber wie auch nicht? Meine Freundin Henrietta – meine ehemalige Zofe, mein Lichtblick im goldenen Käfig, meine selbstgesuchte Familie – würde Joakim kennenlernen. Joakim – meinen erzwungenen Bettlerehemann, meinen Lügenprinz, mein … Gegenstück. Sie mussten einfach gut miteinander auskommen. Sie mussten.
„Wann wirst du singen?“, fragte ich Joakim, um mich selbst abzulenken. „Direkt wenn wir ankommen oder kurz bevor wir wieder gehen?“
Joakim warf mir einen Seitenblick zu. „Vielleicht will ich gar nicht singen.“
„Du willst immer singen.“
„Vielleicht will ich jede Minute nutzen, Henrietta besser kennenlernen? Immerhin habe ich ihr zu verdanken, dass hinter all deiner Rüstung doch noch ein Stück Herz übrig geblieben ist.“
„Hm“, machte ich. „Ungünstig.“
„Was?“
„Es könnte sein, dass ich ihr vielleicht etwas viel über dein magisches Gesangstalent erzählt habe. Eventuell wird sie darauf bestehen, dich zu hören.“
„Ach. Also muss ich wieder ausgleichen, dass du den Mund zu voll genommen hast?“ Joakim griff nach meiner Hüfte und ich war nicht schnell genug, um auszuweichen. Er erwischte mich in der Seite, sodass mir ein unfreiwilliges, hohes Geräusch entwich.
Ich schlug nach ihm. Er lachte. In seinen braunen Augen funkelte es heller, als es der graue Himmel hätte erlauben sollen.
Verdammt, meine Lippen zuckten ebenfalls.
„Du musst spielen“, erklärte ich. „Andernfalls büßt deine Frau für immer ihre Glaubwürdigkeit ein.“
Deine Frau? Verdammt, das war mir einfach herausgerutscht. Hastig schob ich hinterher: „Und das willst du doch nicht, oder?“
Von seinen Augenwinkeln breiteten sich zarte, sanfte Falten aus. „Meine Frau, sagst du? Wer ist denn das?“
Mein Herz schlug mir bis zum Hals, versuchte es mir jedoch nicht anmerken zu lassen. „Ich.“ Ich improvisierte einen Knicks. „Gestatten: Mirelle, Spielmannsbraut.“
Seine Brauen wanderten nach oben. „Du definierst dich über mich? Womit habe ich das denn verdient?“
„Wer sagt, dass das nicht in beide Richtungen gilt?“
„Du meinst …“ Er tippte sich gegen die Brust. „Töpferinbräutigam?“
„Golem“, korrigierte ich automatisch.
Denn trotz der vielen anderen Gedanken, die noch an der Bezeichnung hafteten, war er das, nach wie vor. Immerhin war Xandras Arie über ihren Golem der Auslöser gewesen, weshalb sich Joakims Lügennetz plötzlich aufgedröselt hatte. Aber auch nur, weil er sie immer und immer wieder gesummt hatte.
„Hm“, machte Joakim. Und als wäre es eine Aufforderung gewesen, als hätte er die komplizierte Melodie ohnehin ununterbrochen im Kopf und würde er ihr lediglich erlauben, nach außen zu dringen, stimmte er ein paar Takte der Arie an. Mit Worten diesmal. Ich verstand nicht, woher er den Mut dafür nahm, wie er so viel Offenheit in seine Stimme legen konnte. Sie nahm mich sofort gefangen, legte mir eine Gänsehaut auf den Arm, kroch mir hinauf bis in den Nacken.
Ich musste mich räuspern, als er verstummte. „Siehst du. So ein Talent glaubt mir Henrietta nicht.“ Ich zog meinen Ärmel ein Stück hoch, zeigte ihm die aufgestellten Haare wie einen Vorwurf. „Du musst singen.“
Joakim schien erst nicht zu begreifen, was ich ihm zeigte. Vorsichtig berührte er meinen Arm, als würde es sich unter seinen Fingern auflösen. Das verstärkte die Gänsehaut noch. „Das war ich? Nicht die Kälte?“ Er sah auf, suchte in meinem Gesicht. „Du weißt, wenn es dir wirklich wichtig ist, dann könntest du mich einfach darum bitten. Du musst nicht … dieses Schauspiel …“
Ich verdrehte die Augen. „Natürlich ist es nicht die Kälte. Ich hätte unzählige Decken in meinem Beutel, die ich mir umlegen könnte, um das zu verhindern.“
Seine Finger strichen erneut über meinen Arm und diesmal kroch mir der Schauer sogar das Rückgrat hoch, bis über die Kopfhaut. Er war nah. Nah genug, dass ich einen Hauch seines Geruches nach trockenem Nadelwald riechen konnte. Nah genug, um das Braun in seinen Augen vom Schwarz unterscheiden zu können. Nah genug, dass ich ihn küssen wollte.
„Also offenbarst du mir bereitwillig deine starken Emotionen? Siehst du das nicht sonst als Schwäche an?“, murmelte er.
„Meinst du nicht, darüber sind wir längst hinaus? Bei allem, was wir schon miteinander geteilt haben?“
In seinen Augen blitzte es auf. „Stimmt. Manchmal glaube ich, es läuft zu gut zwischen uns.“ Sein Blick driftete zu meinem Mund ab.
Ich schluckte. Dort, wo er mich am Arm berührte, stieg Hitze auf. „Zu gut?“, hakte ich nach.
„Morgen wache ich auf und erfahre, dass es doch alles nur ein Traum war.“
„Ich würde dir gerne versprechen, dass es kein Traum ist.“
„Aber …?“
„Aber das kann ich nicht. Für mich fühlt es sich ebenfalls so gut an, dass es ein Traum sein könnte.“
Ganz langsam, vorsichtig, breiteten sich die Fältchen um seine Augen aus. „Dann lass uns einfach gemeinsam weiterträumen“, sagte er leise und beugte sich weiter zu mir hinab. „Der Rest ist mir gleich.“
Ich lehnte mich ihm entgegen, bis sich mein Atem mit seinem mischte. Nur noch von einem Hauch getrennt. Gemeinsam in der Schwebe.
Dann überbrückte er das letzte Stück und ich fühlte seinen Mund auf meinem, sanft und warm. Abrupt sackte mein Magen ab, als wäre ich über einen Klippenrand gestolpert. Reflexhaft schoss meine Hand hoch, grub meine Finger in seinen kratzigen Bart. Seine Zunge stieß gegen meine, prickelnde Hitze stieg in meinem Inneren auf. Es hätte sich nicht so gut anfühlen dürfen. Nicht jedes Mal besser. Keine Gewohnheit, die sich abnutzte, sondern eine, die durch Wiederholung wuchs. Seine Finger, noch immer an meinem Unterarm, zogen mich näher zu ihm, bis mein Körper sich gegen seinen drückte. Bis meine Welt nur noch aus ihm bestand und ich doch nicht genug von ihm hatte. In meinem Kopf überlagerten sich Bilder vom Vortag, davon wie sich seine bloße Haut auf meiner angefühlt hatte, während er mich gegen die Tür unserer Waldhütte drückte. Das war es, was ich wieder wollte. Mehr Haut von ihm, noch mehr Berührung, noch mehr –
Jemand pfiff anzüglich.
Es bohrte sich verspätet in meinen Verstand, ließ den Moment zersplittern. Wir brachen auseinander, atemlos, ohne jedoch den Blickkontakt zu lösen. Wir rangen beide um Atem.
„Frisch verheiratet?“, rief eine Stimme aus unserem Publikum und andere antworteten mit Gegröhle.
„Ja“, gab Joakim zurück, ohne sich umzusehen. In seinen Augen rang Hitze mit Belustigung. „Wo ist der einsame Wald, wenn man ihn braucht?“, ergänzte er leise, nur für meine Ohren, während sich die Stimmen entfernten.
Ich musste lachen, aber es klang rau. Etwas kratzte in meinem Hals, meine Knie fühlten sich zittrig an. Nach allem, worüber wir gerade geredet hatten, war das hier zu nah dran, glich zu sehr dem Aufwachen aus einem Traum. Dabei verstand ich selbst nicht, warum. Nur weil wir unterbrochen worden waren?
Frisch verheiratet, hallte es in meinem Kopf nach. Waren wir das denn? Die Spielmannsbraut war mit dem Golem verheiratet, aber nicht die Prinzessin mit dem Prinzen. Damit eine Ehe zwischen Adligen innerhalb der Verbündeten Länder rechtsgültig war, brauchte es die Anwesenheit eines Vertreters des Rates der Verbündeten Länder, der die Ehe im Namen aller sieben Reiche bezeugte. Aber den hatte es bei uns nie gegeben. Streng genommen waren wir also nur verheiratet, solange wir unsere Herkunft leugneten.
Und?, fragte der andere Teil von mir. Seit wann spielt das eine Rolle?
Tat es nicht. Ebenso wenig wie es eine Rolle spielte, dass es einige unter den hochrangigen Adligen gab, die sich womöglich betrogen fühlten, wenn sie erfuhren, dass sich meine Strafe, der Bettler, über Nacht als Prinz entpuppt hatte, ohne dass ich Demut gelernt hatte. Womöglich würde es sogar diplomatische Auswirkungen auf Agarmundt haben, schließlich war es sein Prinz gewesen, der die Strafe abgemildert hatte.
Aber das alles war nicht wichtig. Das hier war unsere heile Welt jenseits vom Adel, unsere Welt mit unseren Regeln.
Ich schüttelte die Gedanken ab und griff nach Joakims Hand, schob meine Finger zwischen seine. Die Berührung glättete sofort alle Verwirrung, alle Zweifel in mir. Es fühlte sich richtig an, real.
„Dann lass uns weitergehen und möglichst schnell in unseren einsamen Wald zurückkehren“, schlug ich vor.
Joakim entfuhr ein überraschtes Lachen. Abrupt beugte er sich zu mir herüber und drückte mir einen Kuss auf die Schläfe, löste kleine nervöse Strudel in meinem Bauch aus. „Das ist doch mal ein Versprechen.“ Dann zog er mich weiter.
Allmählich nahm die Menschendichte auf dem Weg zu, nach einer Biegung kamen die Stadttore in Sicht: zwei schlanke Türme, verbunden über einen Balken, dessen Fassade mit einem bunt gebänderten Muster geschmückt war, zusammengesetzt als Mosaik aus winzigen Scherben. In der Ferne, auf einer leichten Erhebung im Stadtkern, waren bereits die gedrechselten Türme von Kronprinz Leonards Schloss zu erkennen.
Wir passierten das Tor genau in dem Moment, in dem die Sonne zwischen den Wolken hindurchblinzelte. Als würde sie uns persönlich in der Stadt begrüßen, uns alles im besten Licht präsentieren wollen.
Joakim ließ meine Hand los und zog den Beutel mit seiner Laute nach vorne, um sie vor dem dichter werdenden Menschenstrom besser abschirmen zu können. Dann suchte er wieder nach meinen Fingern und hielt sie fest. Gemeinsam mit den anderen Besuchern flossen wir an den Seiten der Hauptstraße entlang auf das Zentrum zu, während neben uns Pferdekutschen vorbeiratterten.
„Vielleicht war es doch keine gute Idee, an einem Markttag zu kommen“, raunte Joakim mir von der Seite ins Ohr.
„Aber nur das garantiert ein größeres Publikum und mehr Einnahmen. Zumindest war das mal der Plan, bevor du beschlossen hast, doch nicht singen zu wollen.“ Ich warf ihm einen Seitenblick unter gehobenen Brauen zu.
Joakim grunzte nur. Oder eigentlich wusste ich nur, dass er es tat; der Lärm ringsherum verschluckte den Laut.
Vielleicht war es Joakims Unwillen, vielleicht die Umrisse des Schlosses in der Ferne, aber plötzlich fragte ich mich, ob es überhaupt klug wäre, dass Joakim sang. Unmittelbar dort, wo meine ehemalige Zofe angestellt war – würde mein Vater womöglich Spitzel positioniert haben?
Alte Denkmuster. Anscheinend brauchte ich nur in die Nähe der höfischen Welt gelangen, um überall Schatten und Intrigen zu sehen. Selbst wenn mein Vater hier seine Informanten hätte, gab es ihm noch lange nicht die Macht, uns hier festzusetzen. Vor allem nicht vor den Augen der königlichen Gouvernante von Garenien.
Ich atmete tief durch. Und endlich öffnete sich auch die Straße vor uns, der Abstand zwischen den Häusern wurde breiter, wurde zu einem Platz, durchkreuzt von den beiden Hauptstraßen. Die wöchentlichen Märkte hier in Garenien waren anders organisiert als in Sahrmingen oder Agarmundt. Der Handel fand nicht an Ständen im Freien statt, sondern unter den Säulengängen, die das ebenerdige Geschoss der Gebäude ringsum einnahmen. Der Vorteil: Die Auslagen war regengeschützt. Der Nachteil: Alles war konzentrierter. Mehr Leiber dicht an dicht, mehr stehende Luft, mehr Farben, mehr Gerüche. Zudem reflektierten sich die Stimmen unter der Decke des Gangs, steigerten den Geräuschpegel um ein Vielfaches.
Unwillkürlich fragte ich mich, ob Joakim, wenn er sang – falls er sang – es tatsächlich im Markt tun könnte oder ob er es lieber auf dem Platz davor versuchen sollte.
Joakim atmete sichtbar auf, sobald der Hauptstrom an Menschen zu den Ständen abzweigte und uns auf den freien Platz in der Mitte ausspuckte. Er schob den Beutel mit der Laute wieder auf den Rücken und fuhr sich mit der Hand übers Haar. „Wo ist der Treffpunkt?“
„An der westlichen Ecke, beim Tuchhändler. Henrietta behauptet, die Stände hätten oft dieselben Plätze wie in den Wochen zuvor.“ Ich ging bereits voraus, suchte mit dem Blick die Umgebung ab, versuchte zu erkennen, was sich in den Säulengängen abspielte. Leute und noch mehr Leute schoben sich an den Ständen vorbei, verdeckten die Sicht auf die Waren. Dennoch entdeckte ich den Tuchhändler am äußersten Ende. Henrietta hatte ihn offensichtlich mit Bedacht gewählt: Er hatte seine Tücher aufmerksamkeitswirksam bis unter die Decke gespannt, war dadurch nicht zu übersehen.
Und Henrietta ebenfalls nicht. Selbst zwischen den vielen Leuten fiel ihre Frisur sofort auf, ihr geflochtener Haarkranz war unverwechselbar. Neben ihr stand ein Mann, die Haare mit einem gemusterten Band im Nacken zusammengefasst. Friedrich, ehemaliger Zeremonienmeister meines Vaters. Henriettas Ehemann.
Ein letzter Atemzug noch außerhalb des Gedränges, dann schob ich mich hinein, arbeitete mich zu Henrietta durch und schloss sie ohne Vorwarnung von der Seite in die Arme.
Sie stieß ein Quietschen aus. „Himmel, Mirelle!“ Sie schnappte nach Luft. „Eines Tages bringst du mich noch um.“„Aber es wäre ein glücklicher Tod.“ Ich ließ sie los.
Sie lachte und versuchte, ihr Schultertuch wieder ordentlich zu arrangieren. „Da will ich mich noch nicht festlegen.“
Sie hatte weniger Schatten unter den Augen, als ich es von früher gewohnt war. Etwas, das mir schon bei unserem letzten Treffen aufgefallen war. Weil ich sie nicht mehr zu nächtlichen Ausflügen nötigte? Oder lag es an Friedrich? An Garenien? Ansonsten sah sie aus wie immer. Vielleicht ein bisschen runder, aber das konnte auch Einbildung sein. Allerdings war ihre Kleidung ganz anders als früher. Sie hatte die schlichten Farben aufgeben müssen. Selbst das Tuch, das sie sich zum Schutz gegen die Herbstkühle um die Schultern gelegt hatte, war zweifarbig gewebt – blau und petrol – und zusätzlich unendlich filigran mit roten und gelben Schnörkeln bestickt. Vermutlich war es noch das Schlichteste, was sie hatte auftreiben können, wenn ich mir die Tuchauslagen ringsum so besah. Garenien liebte es bunt – in der Kleidung ebenso wie in den Wandbemalungen. Und genau das gefiel mir.
Ich warf einen Blick zu Friedrich, in sein langes schmales Gesicht und die durchdringenden hellen Augen. Er hatte wie immer die dunkelblonden Haare zu einem Zopf im Nacken zusammengefasst, die Wangen waren bis auf die Koteletten glatt rasiert. Das letzte Mal hatten wir uns nur flüchtig gesehen, er hatte Henrietta und mir sofort Zeit zu zweit eingeräumt. „Wie geht es dir? Euch?“
„Willst du uns nicht erst deine Begleitung vorstellen?“, schlug Henrietta vor.
„Meine Begleitung kann das eigentlich ganz gut alleine. Du willst nur dem Thema ausweichen.“ Trotzdem drehte ich mich zu Joakim um.
Er war stehen geblieben, gerade noch außerhalb des Säulenganges. Zum Schutz der Laute. Hoffte ich zumindest. Sein dunkler, aufmerksamer Blick wanderte wieder und wieder zwischen Henrietta und mir hin und her, dann zwischen Henrietta und Friedrich.
Ich hob auffordernd die Brauen und er trat zumindest ein paar Schritte auf uns zu. Ein Blick auf Henrietta und Friedrich, und wir bewegten uns alle mehr in seine Richtung, verdrängten die Marktbesucher zwischen uns.
„Joakim, freut mich euch endlich kennenzulernen“, sagte er und nickte zur Begrüßung.
Henrietta sah mich bedeutungsvoll an. Abwartend. Noch immer darauf bedacht, mir Manieren beizubringen.
Ich seufzte. „Henrietta und Friedrich“, ergänzte ich und deutete auf die beiden.
Henrietta sank in einen Knicks, Friedrich verbeugte sich. Die Bewegung verursachte einen merkwürdigen Nachhall in mir. Förmliche Begrüßungen, die ich seit Wochen nicht mehr gesehen hatte.
Joakim machte unvermittelt einen Schritt zurück. „Ich bin hier nicht …“, setzte er an, räusperte sich. „Ich bin nur noch der Spielmann.“
„Natürlich“, versicherte Henrietta prompt. Eine leichte Röte legte sich auf ihre Wangen. Weil sie es als Vorwurf interpretierte?
„Stimmt es denn …“, setzte Henrietta an, schloss dann jedoch den Mund, ohne den Satz zu beenden. Sie warf einen kurzen Blick zu Friedrich hoch, die Färbung ihrer Wangen nahm noch weiter zu.
„Ich glaube“, übersetzte ich für Joakim, „sie würde dich gerne fragen, ob du als Spielmann heute eine Vorführung geben wirst oder nicht.“
„Mirelle!“, entfuhr es Henrietta.
„Liege ich falsch?“
„Nein. Aber …“
„Wirst du?“ Ich drehte mich zu Joakim.
Er hob die Brauen. „Ich dachte, wir sind hier, damit wir uns gegenseitig kennenlernen.“
„Und dein Gesang zählt nicht dazu?“
„Das meinte ich nicht. Wie sollen wir uns bitte gegenseitig kennenlernen, wenn du das Gespräch für uns führst?“
Ich lachte. Ertappt. „Wahr. Ich versuche mich zu zügeln.“
Aber Himmel, ich war so ungeduldig, aufgeregt, angespannt. Ich wusste gar nicht wohin mit mir. Es war unerträglich, daneben zu stehen und nur zuzusehen, wie sie sich mehrere Augenblicke gegenseitig musterten und schwiegen. Als wüssten sie gar nichts miteinander anzufangen. Oder als wüssten sie vielleicht auch einfach zu viel übereinander, und würden damit kämpfen, sich noch ein eigenes Bild aufzubauen.
„Mirelle sagt“, eröffnete Joakim schließlich, „du bist ihre wahre Familie.“
Henrietta warf mir ein überraschtes Lächeln zu. Hatte ich ihr das nie gesagt?
„Und du …“ Henrietta wandte sich wieder an Joakim. „Mirelle sagt, du wärst der beste erzwungene Ehemann, der ihr passieren konnte. Und ich glaube, sie war bereits ein kleines bisschen in dich verliebt, seitdem sie dich das erste Mal hat spielen hören.“
Joakims Blick schoss überrascht zu mir.
„Nicht euer Ernst!“, platzte ich heraus.
„Was hast du erwartet?“ Henrietta lächelte unschuldig. „Dass du uns Dinge über den jeweils anderen erzählen darfst, ohne dass wir es dir zurückzahlen?“
„Erst darf ich nichts mehr sagen und dann wiederholt ihr nur Aussagen von mir? Wie wollt ihr euch so kennenlernen?“
Joakims Mundwinkel zuckten. „Ich habe das Gefühl, wir haben uns dadurch schon recht effektiv verbündet.“
„Nichts schweißt so gut zusammen wie ein gemeinsamer Feind“, kommentierte Friedrich. „Habe ich Feind gesagt? Ich meinte natürlich Freund. Ein gemeinsamer Freund.“
Sie lachten alle und auf meine Kosten. Aber irgendwie war es mir herzlich egal, solange sie sich dadurch gut verstanden.
„Na schön“, meinte ich. „Wenn ihr das mit dem gegenseitigen Ausfragen und dem vorsichtigen Herantasten überspringen wollt, dann gehe ich eben auch direkt zum nächsten Tagespunkt über.“ Ich zog den Beutel von meinem Rücken nach vorne und öffnete ihn. Oben auf den Tüchern lag das unscheinbare Bündel aus ungefärbter Wolle, umwickelt mit einer Kordel und einem winzigen Sträußchen getrockneter Blumen. Ich holte es heraus. Ich warf einen Blick zu Friedrich, dann zu Henrietta. „Ich bin nicht gut mit Worten –“
Joakim schnaubte, Henrietta schnalzte amüsiert mit der Zunge.
„Schön, ich bin nicht gut mit persönlichen, emotionalen Worten. Deswegen … hier, das ist für euch.“ Ich drückte es Henrietta in die Hand.
„Ist das gestrickt? Ist das von dir gestrickt?“, wollte sie wissen, während Friedrich sich interessiert näher beugte.
„M-hm.“ Nervös griff ich nach Joakims Hand. Was, wenn sie es albern oder unförmig fand?
Henrietta zog behutsam die Schleife auf. Friedrich nahm ihr Band und Blumen ab, damit Henrietta das Bündel auseinandernehmen konnte. Es waren zwei Teile. Das eine war einfach gewesen: eine kleine Decke, ihre Seiten gerade einmal so lang wie mein Arm. Das zweite hatte mich mehrere Versuche und unzählige Flüche gekostet: eine Mütze. Eine sehr kleine Mütze.
Henrietta entschlüpfte ein undefiniertes Geräusch. Hastig presste sie eine Hand auf den Mund, um es zu ersticken.
„Ich hoffe, ihr könnt es gebrauchen“, sagte ich hastig. „Und das Geschenk ist gewissermaßen auch von Joakim. Ohne sein Zureden wäre die Mütze niemals fertig geworden. Ich hatte schon dreimal aufgegeben.“
„Herzlichen Glückwunsch“, ergänzte Joakim. „Wir wünschen euch dreien alles erdenklich Gute.“
Henrietta sagte nichts, stürzte nur nach vorne. Zog erst Joakim in einem unbeholfene Umarmung, dann mich. Ihre Wange war feucht, als sie sie gegen meine drückte. Waren es meine oder ihre Tränen? Ich schlang die Arme ebenfalls um sie, mein Brustkorb fühlte sich gleichzeitig zu weit und zu eng an.
„Ich freue mich so für euch“, murmelte ich und rieb ihr über den Rücken.
Henrietta hatte es sich so sehr gewünscht, Mutter zu werden. Und sie beide, Friedrich und sie, würden gute Eltern werden, gute Eltern, die ihrem Kind Liebe und Geborgenheit auf den Weg mitgaben. Nicht so wie meine.
Meine Freundin löste sich von mir, um mich anzusehen. Wir mussten beide auflachen, als wir das in Tränen aufgelöste Gesicht der anderen sahen.
„Das wird das erste Kind in der Geschichte der Welt, das eine Mütze trägt, die von einer Prinzessin gestrickt wurde“, meinte Henrietta und versuchte sich mit dem Handrücken die Spuren von den Wangen zu wischen, auch wenn immer wieder Nässe nachkam.
„Ehemalige Prinzessin“, korrigierte ich reflexhaft.
Ein kaum sichtbares Stirnrunzeln. „Aber ihr …“ Ihr Blick glitt kurz zu Joakim ab, dann wieder zu mir. „Er ist doch …“
Ein Prinz. Und du seine Frau. Sie brauchte es nicht aussprechen, damit ich es verstand.
Ich winkte ab. „Nicht nach den Regeln des Adels der Verbündeten Länder.“ Warum lief es schon wieder auf dieses Thema hinaus?
Sie nickte zögernd. Nickte noch einmal. Dann weiteten sich ihre Augen leicht. „Oh!“, entfuhr es ihr. „Oh richtig! Das hätte ich fast vergessen.“ Sie drückte Friedrich das Geschenk in die Hand und begann in ihren Rocktaschen zu kramen.
„Ich habe noch …“ Aber sie beendete den Satz nicht, zog nur einen Gegenstand nach dem anderen heraus – ein unbenutztes Stofftaschentuch, ein winziges Büchlein, einige bunt bemalte Holzkugeln und eine künstliche Blüte. Nichts davon sah aus, als würde sie es absichtlich mit sich herumtragen. Eher, als wären ihre Taschen die schnellste Lösung, immer wenn sie etwas außer Reichweite eines der Kinder von Kronprinz Leonard bringen musste.
„Hier.“ Sie zog einen sichtlich ramponierten Brief heraus, strich ihn glatt. „Tut mir wirklich leid. Ich trage ihn schon den ganzen Tag mit mir herum.“
Ich ließ Joakims Hand los und nahm ihn entgegen. „Für mich?“
„Ja. Er war in einem anderen Brief enthalten, mit der Anweisung, den hier an dich weiterzuleiten. Er ist von –“
Plötzlich hämmerte mir mein eigener Herzschlag in den Ohren, mein Hals war trocken. Ich hatte den Brief umgedreht. Das Wachssiegel gesehen. Ein Greif. Joakims Wappen.
„König Laurent.“
Die Erinnerungen waren Ungeheuer, die mich hinterrücks überfielen. Ein Blick auf ein königliches Siegel und alles war wieder da. Die Anspannung, um ja keinen Fehler zu machen. Die Angst davor, was passieren würde, falls ich es doch tat. Ich stand wieder in einem Saal voller Freier, König Laurent im sandfarbenen Anzug mir gegenüber, und der weitere Fortgang meines Lebens hing davon ab, dass ich gewitzt genug war, ihnen allen das Interesse an mir zu nehmen. Ich kniete wieder auf dem Ballsaal von Schloss Lavalle und König Laurent versuchte mich fortzubringen, fort von Joakim, während Dutzende Höflinge hinter ihren Masken auf mich herabsahen.
Ich merkte erst, wie sehr meine Finger bebten, als Joakim seine Hand um meine schloss. Die zweite legte er auf meinen Rücken, federleicht und doch mit all der Stärke, die mir in dem Moment fehlte. „Er muss gewusst haben, dass du früher oder später Henrietta besuchen würdest.“
„Aber was will er?“
„Ich weiß es nicht“, meinte Henrietta, „In dem anderen Brief, den an mich, stand nur, dass er sich für die Ironie entschuldigt, weil er die Zofe vorschickt.“
Wenn Prinzessin Mirelle mit mir reden will, soll sie selbst kommen.
Meine Hände waren schwitzig. Ich wollte den Brief nicht. Ich wollte ihn Henrietta zurückgeben und vergessen, ihn je gesehen zu haben. Verbrennen. Joakim hatte mir gegenüber so oft betont, dass Laurent nicht der schlechte Mensch war, als den ich ihn kennengelernt hatte. So wie ich auch nicht der schlechte Mensch war, für den Laurent mich hielt. Aber trotzdem …
„Vielleicht ist es ganz harmlos“, sagte Henrietta sanft.
Ich schnaubte. „Sicherlich. Er will nur fragen, wie es mir geht. Und dafür macht er sich die Mühe, den Brief durch dich überstellen zu lassen.“
„Du hast dir auch die Mühe gemacht, ihm zu schreiben. Vielleicht will er das Entgegenkommen nur erwidern und sich ebenfalls entschuldigen.“
Mein Herz sank wie ein Stein in meinen Magen. Für einen Moment fühlte ich mich wie gelähmt. Sie hatte nicht … Henrietta hatte das jetzt nicht wirklich gesagt, oder?
Joakims Hände glitten von mir ab. „Du hast was?“
„Verdammt, Henrietta“, murmelte ich. Nicht wütend auf sie, sondern auf mich. Ich hätte damit rechnen müssen. Ich hätte sie irgendwie beiseite nehmen und vorwarnen müssen. Ich hätte es Joakim schon vor Tagen sagen müssen. Stattdessen hatte ich es aufgeschoben. Immer wieder. Und jetzt war es zu spät.
„Was?“, fragte sie arglos.
Ich seufzte. „Er wusste es nicht.“
„Du … Du hast es ihm nicht … Aber ich dachte … Ich dachte, er wäre der Grund …“ Sie schüttelte den Kopf. „Aber warum hast du es nicht erzählt?“
Weil das der Teil war, über den wir schwiegen. Weil wir unsere Familien, die Politik – einfach alles aus unserem Leben zuvor mieden. Ich hatte nicht diejenige sein wollen, die es auf den Tisch brachte, wenn es nicht nötig war.
Ich wandte mich zu Joakim um. Joakim, der verdächtig still war. Seine dunkle Augen lagen auf mir, beinahe zu intensiv und aufmerksam, um ihren Blick zu erwidern.
„Das letzte Mal, als ich hier war“, erklärte ich knapp, „habe ich allen Freiern, an die ich mich erinnern konnte, eine Entschuldigung geschrieben.“
„Warum?“ Ein einziges Wort. Es verriet trotzdem all den zurückgehaltenen Vorwurf seinerseits.
Erst jetzt wurde mir klar, dass ich darauf gehofft hatte, dass er erleichtert sein würde, wenn er davon erfuhr. Dass die positiven Gefühle den anderen Aspekt überdecken würde: dass ich es hinter seinem Rücken getan, über Wochen vor ihm geheim gehalten hatte.
Ich öffnete den Mund, zögerte jedoch. Irgendwie wusste ich, wie das hier ausgehen würde. Wir würden uns streiten. So heftig wie seit dem Maskenball nicht mehr. Das hier war der Einbruch der Realität in unsere Scheinwelt.
Joakim kam mir zuvor, er griff nach meiner Hand. „Warte“, sagte er. „Ich ziehe die Frage zurück. Vorerst. Wir haben nur diesen Nachmittag mit Henrietta und Friedrich. Der Brief kann warten.“
Und dafür liebte ich ihn in diesem Moment. Weil es zeigte, wie wichtig dieses Treffen ihm war. Weil er mir genug vertraute, um die Begründung nicht sofort hören zu müssen. Weil er vielleicht selbst daran glaubte, darauf hoffte, dass es zwar ein Streit sein würde, aber keiner, der an dem rütteln würde, was wir miteinander hatten.
Innerlich, musste ich zugeben, hatte ich es geahnt. Hatten wir es beide geahnt und waren deswegen zusätzlich nervös gewesen. Das hier war nicht nur ein Treffen zwischen zwei Menschen, die mir wichtig waren. Es war die Zusammenführung meines neuen Lebens mit einem Teil meines alten, ein Treffen mit einem Abzweig der höfischen Welt. Die Verbindung mochte vielleicht winzig sein, aber sie genügte, um all die Vergangenheit und die politische Wirren mit einem Schlag in unsere Idylle einbrechen zu lassen.
„Danke“, sagte ich leise und ließ den Brief ungelesen in meine Rocktasche verschwinden. Stattdessen wandte ich mich wieder Henrietta und Friedrich zu.
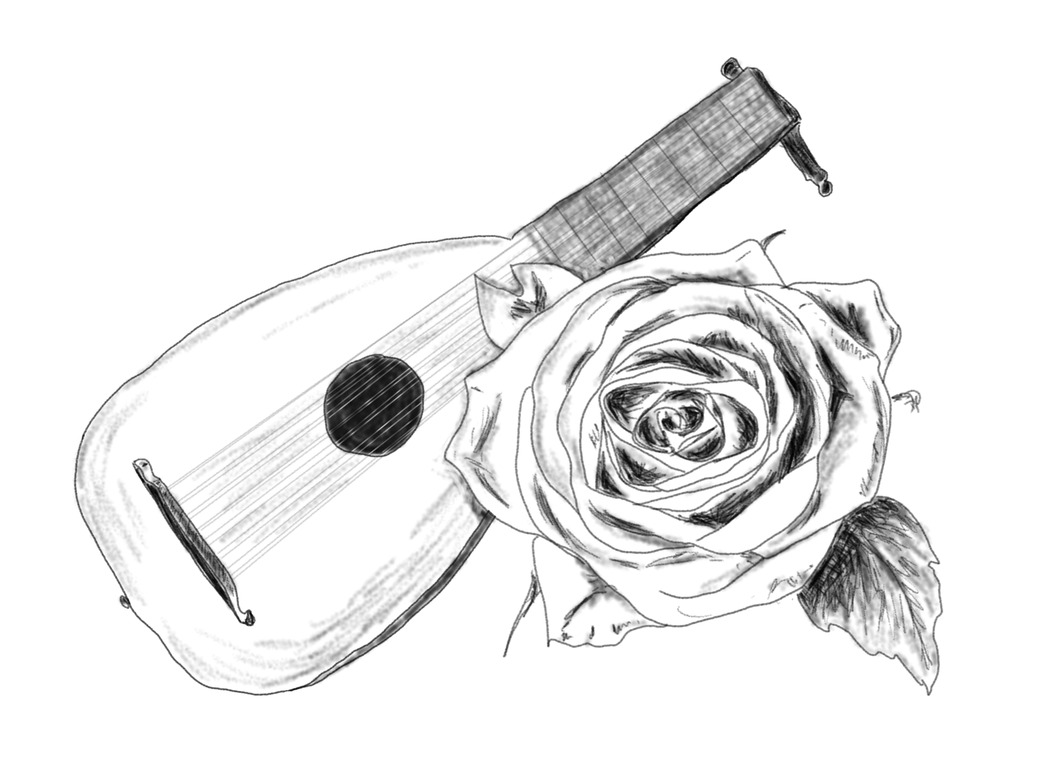
Joakim öffnete die Tür der Waldhütte und trat ins dämmrige Innere. Ich folgte ihm, legte meinen Beutel achtlos auf einem der Schränke ab. Meine Finger wollten der Gewohnheit nach den Wassereimer greifen und Tee aufsetzen. So wie sonst nach einem Tag mit Tonwarenverkauf und Spielmannsgesang. Aber heute war nicht einer solcher Tage. Das Wasser war bereits mehrere Tage abgestanden.
Joakim drehte sich zu mir um, suchte meinen Blick. Eine seiner Hände blieb neben ihm auf dem Beutel mit der Laute liegen. Wie ein Ankerpunkt. Als würde er Kraft daraus ziehen.
„Jetzt?“, fragte er.
Er brauchte nicht auszusprechen, worum es ging. Ohne es abzusprechen, hatten wir beide die ganze Rückreise über das Thema nicht aufgegriffen.
Ich nickte und ging wieder nach draußen, atmete tief die Waldluft ein, den Geruch nach Nadeln, Moos und Laub. Eine Krähe erhob sich zeternd von einem der umgebenden Bäume und flatterte hoch in den Himmel. Leichter Wind strich über die hüfthohen Gräser, gelblich verfärbt nach dem nächtlichen Frost. Auch wenn ich es genossen hatte, diese letzten Tage voller fremder Eindrücke, und mir die Hütte danach wieder unglaublich klein und still vorkam … Ich mochte es hier, jeden noch so kleinen Aspekt davon. Die leicht schiefen Fensterläden der Hütte, über denen ich einmal mein Kleid getrocknet hatte. Die niedrige Bank darunter, die ich für immer damit verbinden würde, dass Joakim auf ihr saß und mit unvergleichlicher Gelassenheit vier Stricknadeln gleichzeitig koordinierte. Oder die Hüttentür, deren Holz ich noch immer im Rücken zu spüren glaubte, wenn ich an den Morgen unseres Aufbruchs nach Garenien zurückdachte. Ebenso wie den Abdruck von Joakims Körper, der sich gegen meinen drängte. Sein Mund an meinem Ohr, meinem Hals, meinem Schlüsselbein. Die bloße Erinnerung ließ prickelnde Luftblasen in meiner Brust aufsteigen.
„Also“, sagte Joakim hinter mir, ganz ruhig, ganz sachlich. Vollkommen unpassend zu den Gedanken, die in meinem Kopf gerade ihr Unwesen trieben.
Ich drehte mich zu ihm um. Versuchte mich zu konzentrieren. Nichts von dem, was hier in den letzten vier Wochen geschehen war, war verloren. Es würde nicht einfach zusammenbrechen. Vielleicht hatten wir beide deswegen diese Aussprache bewusst hinausgezögert, um nicht irgendwo zu streiten, sondern lieber an dem Ort, an dem alles daran erinnerte, was uns verband. Wir konnten, wir würden das hier überstehen.
„Du hast dich per Brief bei den Freiern entschuldigt“, fasste er zusammen. „Sogar bei meinem Bruder. Trotz … seines Verhaltens auf dem Maskenball.“
Ich schüttelte den Kopf. „Wegen.“
Seine Augenbrauen rutschten kaum merklich zusammen.
Ich krallte die Finger in meine Handflächen, um sie daran zu hindern, ihn zu berühren. Er hatte nur die Einleitung liefern wollen und ich hatte bereits neue Fragen aufgeworfen, bevor er zu seiner eigentlichen gekommen war. „Ich habe mich bei ihm unter anderem wegen seines Verhaltens auf dem Ball entschuldigt“, stellte ich klar. „Nicht unbedingt, weil ich ihm verzeihe. Aber weil es gezeigt hat, was für ein falsches Bild wir voneinander haben. Wie sehr er mir misstraut.“
Joakims Blick tastete über mein Gesicht. Vorsichtig, prüfend. „Einfach so?“
„Du hast oft genug gesagt, dass Laurent und ich uns nur missverstanden hätten.“
„Und dann springst du einfach so über deinen Schatten und –“
„Es war nie mein Schatten. Ich wollte doch tatsächlich nie irgendjemanden verletzen. Ich hätte mich bei all meinen Freiern sofort entschuldigt, sofern ich die Garantie gehabt hätte, nicht im gleichen Moment verheiratet zu werden.“
Joakim schnaubte. „Sicher.“
„Mich hat nur nie jemand gefragt.“
Joakim fuhr sich durch die Haare. Nein, er zerwühlte sie regelrecht. Wandte sich halb ab von mir, presste die Lippen zusammen, nur um mich dann wieder anzusehen. Und nichts zu sagen. Obwohl ich sehen konnte, wie es unter der Oberfläche brodelte. Wie die Anspannung seine Schultern, seine ganze Haltung in Besitz genommen hatte. Wie sehr er sich zusammenriss, um das hier nicht in einen ausgewachsenen Streit eskalieren zu lassen. Wie sehr er versuchte, erst die Hintergründe zu verstehen, statt mich direkt mit Vorwürfen zu konfrontieren.
„Sprich es aus“, forderte ich sanft. „Wenn du alle Gedanken für dich behältst, kommen wir auch nicht weiter.“
Er stieß frustriert die Luft aus. „Eigentlich geht es überhaupt nicht um die Entschuldigung. Ich verstehe nur nicht –“ Er brach wieder ab, rang mit sich.
„Ja?“
„Das hier war ein Neuanfang.“ Er deutete zwischen uns hin und her.
Ich nickte.
„Ich hatte das Gefühl, wir hatten die unausgesprochene Übereinkunft, damit alles Vergangene hinter uns zu lassen.“
Ich nickte erneut.
„Alles, Mirelle.“
Ich blinzelte. Das war nicht das, was ich erwartet hatte. „Du machst mir einen Vorwurf dafür, dass ich mich per Brief entschuldigt habe? Weil ich dadurch Kontakt zur … Außenwelt hatte?“
„Nein. Ja. Verflucht!“ Er presste eine Faust gegen seine Stirn. Dann nahm er sie wieder weg, sah mich an. „Warum ausgerechnet jetzt, Mirelle? Es sind mehr als nur Briefe und du weißt das. Sie richten sich an hochrangige Adlige; genau wie deine Ablehnung hat jetzt auch die Entschuldigung politische Konsequenzen, sie … Wir meiden seit Wochen jedes Thema, das irgendetwas mit dem höfischen Leben zu tun hat. Was unsere Flucht für diplomatische Folgen hat. Wie unsere Zukunftsplanung aussieht. Weil wir hier ohne all das leben wollten, ohne irgendwelchen Ballast, irgendwelche Anhänge! Und ich habe mir so viele Gedanken gemacht, ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich … Aber jetzt kommst du daher und eröffnest mir, du hast das politische Spiel längst weitergespielt.“
„Das war nicht –“
„Ohne mich einzuweihen.“
„Ich wollte –“
„Ohne mich auch nur im Nachhinein einzuweihen!“
„Ich hatte es vor!“
„Wirklich?“ Er beugte sich vor. „Und wann wäre das gewesen?“
„Himmel!“ Ich warf die Hände in die Luft. „Ich wollte es dir doch erzählen! Gleich nachdem ich von Henrietta zurück war. Aber ich hab immer angesetzt … und wusste dann nicht, wie.“
„Also musst du nicht über deinen Schatten springen, um die Briefe zu schreiben, aber schon, um mir davon zu erzählen?“ Etwas blitzte in seinen Augen auf. Kränkung?
„Du hast es doch selbst gerade gesagt!“, verteidigte ich mich. „Über manche Dinge sprechen wir nicht. Sie auf den Tisch zu bringen, ohne dass es einen triftigen Anlass gegeben hätte, erschien mir zerstörerisch. Und unnötig. Ich hätte es dir gesagt, sobald sich abgezeichnet hätte, dass es relevant werden würde – wenn wir aus irgendeinem Grund wieder einen Abstecher in die höfische Welt gemacht hätten, beispielsweise. Und natürlich hatte ich ein schlechtes Gewissen, aber –“ Ich stockte, seine Worte klangen wie ein warnender Glockenton in meinen Ohren wider. Ich kniff die Augen zusammen. „Moment. Weshalb hattest du ein schlechtes Gewissen?“
„Das können wir gerne im Anschluss ausdiskutieren, aber lass uns bitte ein Thema nach dem anderen behandeln.“
Aber in meinem Kopf wiederholte sich automatisch, was er gesagt hatte. Ohne irgendwelchen Ballast, irgendwelche Anhänge. Meine Gedanken überschlugen sich. „Du hast den Anhang selbst nicht abgeworfen. Du hattest ebenfalls Kontakt. Du …“
„Mirelle!“, entfuhr es ihm, zu gleichen Teilen besorgt und warnend.
Aber mein Verstand war nicht mehr aufzuhalten, jetzt wo ich die Puzzleteile vor mir hatte. Und Joakims Reaktion machte es nicht besser, sie verriet zu viel darüber, wie wenig mir die Antwort gefallen würde.
„Es ist Laurent, nicht wahr?“ Ich starrte ihn fassungslos an. „Du bist weiterhin mit ihm in Verbindung geblieben. Deswegen lässt er nicht nach uns suchen wie mein Vater. Weil er ganz genau weiß, wo du bist. Weil du ihn auf dem Laufenden hältst.“
„Ich werde mich jetzt nicht rechtfertigen“, stieß er aus. „Das kann ich gerne später tun, aber noch haben wir den ersten Punkt nicht beendet.“
„Und womit willst du mich jetzt bitte an den Pranger stellen?“
„Ich will dich nicht an den Pranger stellen. Ich will nur verstehen. Warum hast du es mir verschwiegen?“
„Genauso wie du!“
„Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.“
„Ach, in deinem Fall war es gerechtfertigt, aber in meinem nicht?“
„Du hast dich in all den Wochen zuvor nicht entschuldigt. Warum jetzt, Mirelle? Warum musstest du es jetzt tun, heimlich, ohne mich?“
„Und du? Warum musstest du ihm heimlich schreiben? Oder warum überhaupt? Traust du deinem Bruder so wenig zu, dass du ihn mit den politischen Geschäften nicht allein lassen kannst?“
„Darum geht es doch überhaupt nicht. Ich habe selbst meine Aufgaben, ich kann nicht einfach –“
„Wie hast du es vorher gemacht, als du den Bettler gespielt hast? Oder warst du da auch mit ihm in Kontakt?“
„Das waren nur wenige Wochen, sie waren überschaubar, vorbereitet. In der Zeit konnte ich kürzer treten. Jetzt –“
„Jetzt kannst nicht mehr nur in unserer kleinen Welt sein, so wie wir es abgemacht hatten? Warum hast du es dann überhaupt erst vorgeschlagen? Oder bezog sich die Bedingung nur auf mich?“
„Natürlich nicht! Aber ich habe unterschätzt … Ich bin auch sein Berater, verstehst du? Ich kann nicht einfach –“
„Es geht um Verantwortung. So ist es doch, oder? Bei dir geht es immer um Verantwortung.“
„Du weißt nicht –“
„Doch, Joakim, ich weiß! Denkst du, darum ging es mir nicht?“, entfuhr es mir. Zu laut. Zu scharf.
Es brachte ihn genug aus dem Konzept, um nicht sofort zurückzuschießen. Er starrte mich an, mit steiler Falte zwischen den Brauen und verkniffenem Zug um den Mund.
Ich öffnete den Mund, um noch mehr zu erklären – doch genau in dem Moment drehte er sich abrupt um und verschwand in der Hütte. Statt der Erklärung entschlüpfte mir ein Fluch. Ich wollte auf Dinge eintreten und hatte doch plötzlich nicht einmal mehr Kraft zum Stehen. Frustriert ließ ich mich auf die Bank fallen, vergrub das Gesicht in den Händen. In mir kämpften die widersprüchlichsten Gefühle, wechselten zu schnell, als dass ich sie einzeln hätte festhalten können. Nur Wut war die einzige Konstante. Wut auf das, was wir getan hatten.
Manchmal glaube ich, es läuft zu gut zwischen uns.
Nein. Nein, wir hatten es nicht für zu gut gehalten. Sondern für nicht gut genug. Nicht stark genug. Und um das zarte Pflänzchen, was wir hatten, zu schützen, hatten wir alles Gefährliche aus seiner Nähe verbannt.
Morgen wache ich auf und erfahre, dass es doch alles nur ein Traum war.
Das zwischen uns, das war echt und real, daran zweifelte ich keinen Atemzug lang. Aber es hatte sich nicht real angefühlt, hatte sich niemals so anfühlen können, weil wir es nicht zugelassen hatten. Wir hatten unser Pflänzchen absichtlich kleingehalten, hatten es eingezäunt, ohne Verbindungen nach außen, ohne die Möglichkeit zu wachsen. Das zwischen uns war keine Illusion, aber das ringsherum, die Welt, in der wir uns bewegten, war es. Wir waren so darauf bedacht gewesen, unser Pflänzchen nicht zu zerbrechen, dass es genau daran zerbrechen konnte. Manche kostbaren Dinge durfte man nicht von der Welt abschirmen, um sie zu beschützen. Stattdessen brauchten sie eben diese in all ihrer Fülle, um noch stärker zu werden.
Bei allen Fröschen, was hatten wir nur getan?
Neben mir knarrte die Türschwelle. Ich hob den Kopf aus den Händen, sah zu Joakim auf. Er stand im Rahmen, Wassertropfen im Bart. Anscheinend hatte er sich das Gesicht gewaschen und nur einen Teil wieder abgetrocknet. Seine Methode, um sich runterzukühlen.
Einen kurzen Moment hielten wir gegenseitig unseren Blick. Er hatte noch immer die Falte zwischen den Brauen, aber die Art, wie er da stand, dieses vorsichtige Zögern, das Suchen in seinem Blick, zog etwas in mir zusammen.
Ich stolperte mehr zu ihm, als dass ich ging und zog ihn in eine wortlose Umarmung. Sofort schlossen sich seine Arme um mich, er drückte mich fest an sich.
Unter dem rauen Hemd an meiner Wange konnte ich seinen Herzschlag hören. Meine Hände gruben sich in seinen Rücken. Er roch nach Wald, nach Zuhause und irgendwie auch nach Sommer. Als wäre all die Sonne an ihm haften geblieben. Als würde er sie automatisch auf mich übertragen, sobald ich ihm nah war. Auch jetzt sammelte sich flüssiges Sonnenlicht in meinem Bauch, schickte Wärme in den Rest meines Körpers. Löste all die Knoten in meinem Inneren, ließ alles so simpel und einfach erscheinen.
„Ich gebe dich nicht mehr her“, murmelte ich. „Nur, damit das klar ist.“
Er stieß die Luft aus und es klang beinahe wie ein Lachen. Ein erleichtertes Lachen. Es vibrierte im Brustkorb unter meinem Ohr. „Dann heißt das wohl, wir müssen uns durch diese Angelegenheit durchkämpfen.“
Ich lehnte mich ein Stück nach hinten, um ihm ins Gesicht zu sehen. „Tut mir leid, dass ich es nicht angesprochen habe.“
Eine seiner Hände glitt hoch zu meinen kurzen Haaren, zupfte leicht daran, spielte damit. „Ebenso. Ich fürchte, du hast Recht; ich habe mit zweierlei Maß gemessen.“
Ich hob die Brauen.
„Ich habe Pflicht und Verantwortung vorgeschoben“, räumte er ein. „Dabei hätten sie warten können. Sie haben auch während der Wochen zuvor oft genug gewartet. Aber Pflicht klingt besser, als wenn ich aus Eigennutz den Kontakt gehalten habe.“
„Das heißt nicht für Agarmundt, sondern für Laurent?“
Er schüttelte leicht den Kopf. „Noch schlimmer. Ich wollte … Ich wollte ihm vor allem erklären, wie du wirklich bist. Damit wir ihn auf unserer Seite haben.“
Ich schnitt eine Grimasse. „Mit dem Argument waren meine Entschuldigungsbriefe wohl auch nicht ganz uneigennützig. Immerhin wollte ich die diplomatischen Wogen glätten. Lieber jetzt als später. Falls wir irgendwann beschließen sollten zurückzukehren.“
Für einen Moment sagte er nichts, musterte mich nur. „Willst du das denn?“, wollte er wissen. „Ich meine: zurück?“
Ich löste mich vorsichtig von ihm, brauchte mehr Raum zum Denken. Ich betrachtete unsere Hütte, den Wald. Ging dann ein paar Schritte in die Wiese hinaus, bis sich mein Rock zwischen den Gräsern verfing und ich die Hände auf ihre Köpfe legen konnte. Ich mochte, wie sie an meiner Handfläche kitzelten. Ich mochte den Geruch nach Freiheit hier zwischen den Bäumen. Ich mochte dieses Leben.
„Heute morgen hätte ich nein gesagt“, sprach ich meine Gedanken laut aus. „Aber unser Streit gibt mir das Gefühl, dass das hier nur ein Versteckspiel ist. Eine Zuflucht, eine Pause. Ich hatte gedacht, sie könnte für immer währen. Aber das hier ist nicht das, was wir wirklich sind. Was wir wirklich sein können.“ Ich sah zu Joakim. „Vielleicht hattest du eine Ausrede, um den Kontakt zu Laurent zu halten. Aber die Tatsache ist: Du lenkst Agarmundt ebenso wie dein Bruder. Agarmundt braucht dich. Und du brauchst deine Aufgabe. Du wirst das nicht für immer aufschieben wollen oder können. Also ist die Frage eher wann und nicht ob.“
Joakim kam mir hinterher, griff vorsichtig meine Hand. „Ich schätze deine Rücksicht sehr. Aber sie beantwortet nicht meine Frage. Ich würde gerne wissen, ob du zurückwillst. Nehmen wir an, ich hätte keine Verpflichtungen.“
Ich wollte nicht zurück in die Zwänge, in die Etikette, das künstliche Lächeln, die unzähligen Kleiderschichten. In das Kräftemessen mit meinen Vater, der mir mein Verschwinden nicht verziehen hatte und noch weniger verzeihen würde, wenn ich an Joakims Seite zurückkehrte. In einer Machtposition. Und falls meine Entschuldigung nicht wirksam genug gewesen war, würden vermutlich auch einige meiner ehemaligen Freier mit Unmut reagieren. Es würde Agarmundt in Bredouille bringen.
„Wir könnten alle zwei Monate für ein paar Wochen hierher zurückkehren, oder?“, schlug ich vor. Auch wenn mir der Gedanke schon jetzt ein Ziehen in der Brust bereitete.
„Oder auf einen entlegenen Landsitz ziehen. Wir können alle Bedingungen aufstellen, die wir wollen. Wir sind unsere einzigen Verhandlungspartner.“
Das Bild entlockte mir ein belustigtes Schnauben. „Und Laurent?“
„Wird sich fügen müssen. Dann soll er eben alle paar Wochen zu uns gereist kommen, wenn er mich braucht.“
Überhaupt – Laurent. Ich hatte seine Antwort noch immer nicht gelesen. Vielleicht stellte er ja sogar bereits Bedingungen.
Mit der freien Hand griff ich in meine Rocktausche und zog den Brief heraus, entfaltete ihn. Keine Anrede, er kam direkt zum Punkt.
Entschuldigung dankend angenommen, auch wenn von meiner Seite keinerlei Kränkungen erfahren wurden. Meine Sorge galt und gilt lediglich meinem Bruder. Er war seit diesem ersten Moment besessen – erst von seiner Mission, wie er es nannte, dann, so fürchtete ich, von dir. Vielleicht habe ich mich in deinem Charakter geirrt. Ich habe mir sagen lassen, dass ich zu vorschnellen Urteilen neige. Belehre mich gerne eines Besseren.
Jannes Laurent Fredrik von Agarmundt
Ich überflog die Worte, stockte und las sie direkt noch einmal. Sie waren so entgegenkommend, ohne eine bissige Bemerkung, dass ich beinahe bezweifelte, dass der Brief wirklich von Laurent stammte. Es war zwar keine Entschuldigung, wie von Henrietta prophezeit, aber näher dran, als ich jemals gedacht hätte.
Und clever. Ich musste lächeln. „Er scheint eher schlecht ohne dich zurechtzukommen – wenn er versucht, mich mit einer Herausforderung zu ködern, damit ich dich zurückbringe.“ Ich drehte den Brief so, dass Joakim ihn ebenfalls lesen konnte.
Mit jedem Satz wanderten seine Brauen weiter nach oben. Dann nahm er mir den Brief aus der Hand und drehte ihn um, prüfte das Siegel, als könnte er ebenso wenig wie ich glauben, dass diese Zeilen von seinem Bruder stammten. „Falls du dich das fragst: Ich bin nicht derjenige, den er da zitiert mit den vorschnellen Urteilen“, behauptete er und gab mir den Brief zurück.
Ich schob ihn wieder in die Rocktasche. „Vielleicht hat er in deiner Abwesenheit einen anderen Berater gefunden.“
„Dann scheint er nicht so glücklich mit ihm zu sein, wenn er mich so dringend zurückmöchte.“
„Vielleicht vermisst er auch einfach so deine Gesellschaft.“
„In jedem Fall hätte ich ihn warnen sollen, dass so ein offensichtlicher Köder keine gute Idee ist. Eher der sicherste Weg, damit du das Gegenteil davon tust.“
Ich lachte. „Normalerweise schon. Aber jetzt habe ich vermutlich keine Wahl. Schließlich …“ Schließlich konnten wir nicht für immer hier bleiben. Das war das, was ich hatte sagen wollen. Aber Joakim hatte Recht, das war nicht die einzige Wahl, die zur Verfügung stand. Wir konnten Bedingungen stellen. Wir konnten jede Bedingung stellen, die wir wollten.
Bilder des gestrigen Tages zogen vor meinem inneren Auge vorbei. Die bunten Häuserfassaden von Garenien. Der süße Plunderteig, den Henrietta und Friedrich uns vorgestellt hatten. Henrietta, die mit glänzenden Augen Joakims Auftritt verfolgte und meine Hand umklammerte. Joakim, wie er konzentriert lauschte, während ihm sein garenisches Publikum ein Volkslied beibrachte.
„Mirelle?“
Das Gefühl sprudelte ganz plötzlich in mir hoch, als wäre es aus den Tiefen meines Verstandes freigebrochen. Fernweh. Ich hatte meine Brüder immer schon für ihre Reisen beneidet. Ich hatte Reisebericht nach Reisebericht aus der Bibliothek meines Vaters gestohlen. Und dennoch war mir kein einziges Mal der Gedanke gekommen, dass ich jetzt vielleicht alles tun konnte. Dass ich frei war.
„Wir können alle Bedingungen aufstellen, die wir wollen?“, wiederholte ich.
Joakims Mundwinkel zuckten. „Was heckst du aus? Ich muss wissen, ob ich das Leuchten in deinen Augen anziehend finden darf oder mich besser davor fürchten sollte.“
„Immer beides, natürlich.“ Meine Lippen verzogen sich ganz von alleine zu einem Lächeln. „Pass auf: Meinem Vater wird es auf keinen Fall gefallen, wenn ich auf einer Machtposition lande. Er wird versuchen, unsere Verbindung in den Augen der anderen Länder zu untergraben, wo er nur kann. Es sei denn, wir kommen ihm zuvor. Wie wäre es, wenn wir eine Rundreise machen? Da es in Agarmundts Sinne ist, könnte es doch sicherlich aus königlicher Kasse finanziert werden, oder? Außerdem sollten meine Briefe wenigstens dafür gesorgt haben, dass die anderen Länder uns – das heißt vor allem mich – nicht gleich vor die Tür setzen, sondern empfangen. Dann können wir sie auch noch weiter für uns gewinnen. Ihnen zeigen, wie sehr ich mich …“, ich hob ironisch die Brauen, „… durch dich gebessert habe.“
„Durch mich?“
„Jede Wette, dass sie das schneller glauben, als wenn ich darauf beharre, dass ich schon immer lieb und freundlich war und niemandem etwas Böses wollte. Es bestärkt schließlich ihr männliches Selbstbewusstsein. Bekehrte vorlaute Frau und so weiter.“
Joakim lachte auf. „Allein dieser Satz belegt, dass mir das nicht einmal ansatzweise gelungen ist.“
„Ist das ein Ja?“ Ich fühlte mich beinahe betrunken vor Übermut, vor Vorfreude. Ich legte die Hände auf seine Brust.
Die belustigten Fältchen saßen immer noch in seinen Augenwinkeln. „Das ist ein definitives Nein.“
„Wir könnten auch deine Schwester in Seelind besuchen. Oder nach Gramayre reisen und dort deiner Verflossenen vorführen, was sie verpasst hat und dass du auch ohne sie glücklich –“
„Definitiv nein“, wiederholte Joakim und in seinem Bart blitzte es weiß auf. „Wie kommt es, dass du die schlimmsten Pläne hast, wenn du etwas besonders stark willst? Warum nimmst du nie den geraden Weg?“
Ich runzelte die Stirn. „Und der wäre?“
„Wir können gerne reisen, aber nicht um das Wunder deiner Läuterung vorzuführen. Wir haben uns beide genug verstellt.“
„Aber –“
Er legte seine Hände über meine, hielt sie dort auf seinem Brustkorb fest. „Heirate mich offiziell“, sagte er. „Danach reise ich überall mit dir hin. Als Antrittsreise. Dein Vater wird nicht begeistert sein, ja, aber die anderen Länder werden nicht sofort auf die Barrikaden gehen. Immerhin hast du dich bei den Freiern entschuldigt. Sie werden zumindest mit ihrem persönlichen Urteil über unsere Verbindung bis nach unserem Besuch warten.“
Mein Herz klopfte plötzlich zu stark, beinahe schmerzhaft. Weil ich nicht wusste, wohin mit all den Gedanken und Gefühlen. Ich hatte gewusst, dass es darauf hinauslaufen würde, früher oder später. Wenn wir zurück wollten – gemeinsam –, dann würden wir um eine zweite, offizielle Eheschließung nicht drum herum kommen. Trotzdem hatte ich mir nicht bewusst gemacht, was es bedeutete. Was die Konfrontation mit diesem Plan in mir auslösen würde.
Es war eine Sache, sich in den erzwungenen Ehemann verliebt zu haben, ihn um nichts in der Welt wieder hergeben zu wollen. Es war eine ganz andere Sache, sich noch einmal öffentlich zu dieser Ehe zu bekennen. Noch einmal vor adeligen Zeugen zu heiraten, die sich über die demütigende Ehe mit dem Spielmann gefreut hatten.
Und dann war da noch dieser andere Aspekt, den ich unterschätzt hatte. Wie er sich anfühlte, dieser eine schlichte Satz. Eine Aufforderung. An mich. Weil er uns wollte. Weiterhin. Offiziell.
Ich befreite eine meiner Hände von seinen und schob sie in Joakims zu langes Haar, zog ihn zu mir herab, bis ich meine Lippen auf seine pressen konnte. Es brannte – in meinem Bauch, in meiner Brust, überall da, wo ich ihn berührte. Tat auf absurde Weise weh, weil es sich so gut anfühlte. Weil es so kostbar war, was wir hatten.
Ich löste mich wieder von seinem Mund, ließ meine Finger jedoch in seinem Haar. Seine Lider flatterten wieder auf, der Blick aus seinen braunen Augen heftete sich an meinen. Ein leichtes Lächeln zupfte an seinen Mundwinkeln.
„Das ist kein definitives Nein“, meinte er.
„Es ist ein definitives Ja“, stimmte ich zu. „Allerdings mit Bedingungen.“
Sein Lächeln wurde breiter. „Natürlich mit Bedingungen.“
„Wir heiraten auf dem Landsitz, den du erwähnt hast. Im kleinen Kreis – nur deine Familie, meine Wahlfamilie und der obligatorischen Vertreter des Rates der Verbündeten Königreiche.“ Ich hielt einen Finger hoch. „Und unter keinen Umständen ziehe ich so ein furchtbares Kleid an wie bei der letzten Hochzeit.“
„Von mir aus kannst du barfuß und in Lumpen kommen.“
Ich grinste. „Verlockend.“
„Kommen noch mehr Bedingungen?“
Ich schüttelte den Kopf.
„Dann ist es abgemacht.“ In seinen Augen funkelte es. „Lass uns zusammen die Welt entdecken.“
Copyright Anne Danck